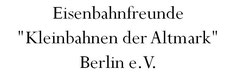Hier geht es um ein Modul, dessen Funktionen entlang der Gleise zur Steuerung des Modellbahnbetriebes wirken und die bisher auf verschiedenen Wegen, -wenn überhaupt-, im Wesentlichen zentral gesteuert wurden. Wegen des komplexen Zusammenspiels dieser Funktionen liegt der Gedanke nahe, diese in einem weiteren, einem neuen Steuermodul zusammenzufassen und mit einem Hybrid-Decoder zu steuern.
Um den Betriebsablauf vorbildgetreu nachzubilden, verwenden Modellbahner die gleichen Strukturen der Gleisanlagen, wie sie vom Vorbild bekannt sind. Deren Struktur ist abschnittsweise organisiert, wobei alle Abschnitte nach ihrer Bedeutung im Betriebsablauf mit einem sich wiederholenden Komplex von Steuer- und Meldefunktionen ausgestattet sind bzw. oder werden können. Somit ist ein Gleisabschnitt als Funktionseinheit zu betrachten.
Die Gleisabschnitte, -kurz: Gleise-, bilden also eine organische Einheit. Wesentlich dabei ist, dass alle Gleise gleichartig, entsprechend ihrer Betriebsaufgabe mit festgelegten und auch ausgewählten Funktionen ausgestattet werden.
Kommen wir zu den einzelnen Gleis-Funktionen, deren Steuerung in einem in einem Steuermodul zusammengefasst werden können. Es sind für den Modellbahnbetrieb notwendige stationäre, entlang des Gleises angeordnete Steuerelemente. Zu unterscheiden sind Aktor- und Sensorfunktionen.
Erstere, z. B. Weichen, beeinflussen den Betrieb durch die Gestaltung der Fahrwege. Sensoren dagegen melden Betriebszustände, wie Gleisbesetzung oder Weichenstellung.
Vergessen darf man nicht, dass bei der Modellbahn das Gleis die wichtige und nicht verzichtbare Funktion der Stromversorgung der Mobilmodelle hat. Die Übernahme des von dem analogen Modellbahnbetrieb bekannten Prinzips, jedem Gleis eine eigene Stromeinspeisung zuzuordnen, ermöglicht es, den Fahrstrom beeinflussende Schalt- und Steuer-Vorgänge selektiv direkt am Gleis durchzuführen. Zumal dadurch neue Funktionen eingeführt werden können, auf die später ein gegangen wird.
Die Fahrstromeinspeisung in ein- oder zweipolig getrennte Gleisabschnitte eines Gleises ist für alle Betriebsstromarten geeignet. Das ermöglicht z. B. ihre selektive Abschaltung zwecks Lastverteilung auf verschiedene Stromquellen, wie Digitalboxen zu verteilen. Hinzu kommt, dass der Laststrom in Gleise niedriger ist und deshalb einfacher zu überwachen ist als der von einer Digitalbox für eine ganze Anlage eingespeiste Strom.
Allerdings sollten aus meiner Sicht Weichen und Signale jeweils ein eigenes direkt gesteuertes Steuermodul erhalten, was ich bereits in Kapitel III behandelt habe. In der Hauptsache deswegen, weil diese Objekte in sehr unterschiedlicher Weise hinsichtlich Bauform und Bauart an der Gleisanlage verteilt sind und deshalb große Abstände zu Steuerzentren entstehen. Das führt wiederum zu mehreren langen Leitungsbündeln, was nur mit ihrer Direktsteuerung vermieden wird.
Das folgende Bild 1 zeigt die Mindestfunktionen eines Modellbahn-Gleisabschnitts, mit denen automatisierte Abläufe gestaltet werden können.
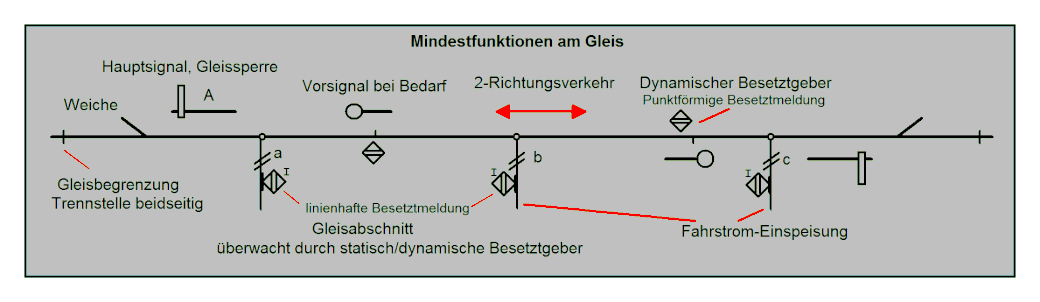
Bild 1 Schematische Modellbahngleis-Darstellung mit relevanten Steuerfunktionen. Diese mit Schaltzeichen aus NEM 602 normierte Darstellung des Gleises bildet die Basis zur Planung einer kompletten Gleisanlage.
Die Darstellung bezieht sich auf ein Modell-Hauptgleis mit Zwei-Richtungsverkehr in einer Standarddarstellung. Mit dieser Ausstattung kann das Optimum der Betriebsabläufe gestaltet werden. Deshalb sind die wichtigen Objekte richtungsabhängig doppelt vorhanden.
Bei Reduzierung der Betriebsaufgaben werden nicht erforderliche Steuerelemente nicht dargestellt, da ihre Funktionen nicht benötigt werden. Beispielsweise werden bei einem Streckengleis die Weichen fortgelassen, bei Ein-Richtungsverkehr entfallen möglicherweise Objekte der nichtgenutzten Richtung oder werden durch andere ersetzt. Allerdings sind die mit dem Fahrstrom verknüpften Funktion immer erforderlich.
Bei dem oben dargestellten Gleis ist an jedem Ende eine Weiche angeordnet, hinter der die Gleisgrenze liegt. Dass abhängig von der Gleisanlagengestaltung auch zwei oder mehr Weichen hintereinander liegen können, soll hier keine Rolle spielen. Ihre Zuordnung zu Gleisen erfolgt nach Zweckmäßigkeit. Wie in Kapitel III beschrieben, wird jede Weiche mit einem eigenen Steuermodul gesteuert.
Für die freizügige Einflussnahme auf den Fahrstrom im Gleis sind Trennstellen vorgesehen. Das gesamte Gleis wird immer durch doppelte Trennstellen begrenzt und bildet so einen eigenen Stromkreis. Außerdem ist es in drei Abschnitte eingeteilt, in zwei kurze (a, c) vor den Signalen und einen größeren Hauptteil (b) in der Mitte. Obwohl es bei Digitalbetrieb die vom Analogbetrieb bekannte Steuerung des Fahrstromes durch das Hauptsignal (Blocksignal) nicht mehr erforderlich ist, empfiehlt sich die Verwendung der Signalgleisabschnitte. Der Hauptgrund liegt darin, dass mit dieser Aufteilung und mehreren Besetztgebern den Standort von Fahrzeugen im Gleis bestimmen kann. Das ist eine Erweiterung der Möglichkeiten bei Betriebsmanövern, z. B. beim Rangieren oder der Darstellung im Gleisbild.
Die Signalgleisabschnitte sind einpolig vom mittleren Gleisabschnitt getrennt und werden separat stromversorgt und überwacht. Zum Gleis gehörende Weichen werden in den Fahrstromkreis der Signalgleisabschnitte a oder c oder, -bei ihrem Fehlen-, in den Fahrstromkreis des Gleises eingeordnet.
Richtungsabhängig vor den Weichen sind Hauptsignale oder Sperrsignale angeordnet, die die Zugbewegungen (virtuell) beeinflussen. Diese signalisieren, ob und wie das nächste Gleis (Folgegleis im Fahrweg) befahren werden darf. Abhängig vom verwendeten Signalsystem können auch Vorsignale angeordnet werden. Damit sind die wichtigen Aktorelemente benannt.
Für die Betriebssicherheit (Schutz vor Karambolagen) sorgen mindestens zwei Sensortypen. Es sind die Besetztgeber und die Weichenstellungsmelder.
Besetztgeber wirken entweder linienhaft entlang des überwachten Gleisabschnitts oder punktförmig an einer vorgegebenen Stelle des Gleises. Die linienhaft nach dem bekannten Prinzip einer Strommessung wirkenden Geber erfassen sowohl ruhende wie fahrende Fahrzeuge (statisch/dynamischer Besetztgeber). Unter der Bedingung, dass sie eine gewisse Leitfähigkeit zwischen den Schienen verursachen. Außerdem darf das Gleis nicht abgeschaltet sein.
Für stehende und/oder bewegte Fahrzeuge sind linienhaft wirkende Sensoren sehr sicher. Deshalb sollten unabhängig von der Art des Fahrstromes (analog oder digital) alle Abschnitte mit den linienhaft wirkenden Besetztmeldesensoren (Besetztgeber) überwacht werden. Ihre Meldungen (besetzt/frei) werden zentral im Gleisbild angezeigt und für Steuerfunktionen ausgewertet.
Das linienhaft erzeugte Besetzt-Meldesignal entscheidet darüber, ob eine Zugfahrt in das Gleis verboten oder erlaubt ist. D. h. letztlich, ob der Fahrstrom/Fahrstufe des im Vorgleis wartenden oder fahrenden Fahrzeugs hoch- oder heruntergestellt wird.
Punktförmig wirkende Besetztgeber werden nur von bewegten Fahrzeugen ausgelöst (dynamisch), sofern nicht ein Objekt an der Geberposition stehen bleibt. Dafür können Schaltkontakte oder Lichtschranken eingesetzt werden, aber auch an den Fahrzeugen befestigte Magnete können Sensoren auslösen. Das so erzeugte Steuersignal kann zur Auslösung bestimmter Funktionen genutzt werden, z. B. zur Reduzierung der Geschwindigkeit vom Vorsignal bis zum Halt zeigenden Hauptsignal und zum Halt am ihm. Auch einige andere punktförmig und selektiv wirkenden Funktionen sind möglich, z. B. zur Steuerung einer Weiche, um die Fahrwege verschiedener Züge automatisch zu trennen.
Die Weichenstellungsmeldesignale werden an der Weiche erzeugt und dem Steuersystem direkt übermittelt. Sie dienen vornehmlich der Fahrwegprüfung aber auch der Steuerung einiger Signalbilder, letztlich der zulässigen Fahrgeschwindigkeit, z.B. eine Weiche abzweigend zu befahren.
Auch die Einspeisung des Fahrstroms ins Gleis sollte gewissen Bedingungen unterliegen. Da ist zunächst die Überwachung der zulässigen Stromstärke. Entgleisungen führen oft zu Kurzschlüssen, deshalb sollte die automatische und bei Gefahrensituationen von Hand ausgelöste Notabschaltung des Fahrstroms direkt am Gleis erfolgen können. Denn eine zentrale Notabschaltung setzt die ganze Anlage still oder Teile davon. Die Funktion Überstromschutz/Notabschaltung kann auch zur gewollten Stillsetzung von Fahrzeugen (Gleis-Abschaltung) genutzt werden. Die linienhaft wirkenden Besetztgeber werden der Fahrstrom-Abschaltfunktion schaltungsmäßig nachgeordnet, somit beeinflusst die Abschaltfunktion die drei Gleisabschnitte a, b, c gemeinsam.
Außerdem ist zu kontrollieren, ob an den Gleis-Trennstellen gleiche Polarität vorhanden ist. Dies ist sowohl für die Vermeidung von Kurzschlüssen wie auch für Wende-/Kehrschleifen wichtig. Die Funktionen Überstromschutz/Notabschaltung und Polaritätsprüfung/Polaritätswechsel können mit den linienhaften Besetztgebern einen elektronischen Komplex bilden.
Ersatzweise können anstelle der einpoligen Zwischentrennstellen auch Punktsensoren eingesetzt werden. Allerdings wird die Möglichkeit beschränkt, den Fahrzeugstandort im Gleis näher zu bestimmen. Punktsensoren nützen zur Ortsbestimmung nur, wenn zufällig ein Fahrzeug im Messbereich steht. Dieser Umstand ist wenig wahrscheinlich, weshalb diese Sensoren nur bei bewegten Objekten sinnvoll sind.
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass mit 1 Fahrstrom-Schaltfunktion, 3 linienhaft und einige -punktförmig wirkende Besetztmeldefunktionen der Fahrbetrieb im Gleis weitgehend optimal gesteuert werden kann.
Noch einmal zurück zur Polaritätsprüfung. Falschpolung verlangt die Umschaltung der Polarität (Umpolung) der Fahrspannung. Die wird benötigt, wenn sich ein Gleis in einem Kehrschleifenbereich befindet. Dann muss während der Durchfahrt eines Zuges oder während seines Halts die Fahrspannung umgepolt werden, gewissermaßen unter dem Zug. Der Wechsel der Polarität hat bei Digitalbetrieb keinen Einfluss auf die Fahrtrichtung, sondern es werden an Trennstellen durch die Räder hervorgerufene Kurzschlüsse vermieden. Diese würden zur Notabschaltung führen.
Die Umpolung bei stehenden Fahrzeugen ist unproblematisch. Es empfiehlt sich aber, ein solches Gleis deutlich länger zu machen als die maximale Zuglänge aller Züge, damit die Umpolung auch während der Gleis-Durchfahrt möglich ist. Im Zusammenhang mit der Umpolfunktion sind Polaritätssensoren an den Trennstellen erforderlich. Dabei ist an jedem Gleis nur ein Polaritätssensor notwendig, unter der Bedingung, dass er richtungsabhängig immer an der der gleichen Seite des Gleises angeordnet wird. Zur Messung der Polarität werden beide Seiten der Trennstelle an einer Schiene kontaktiert und gemessen.
Die beschriebenen Funktionen können in einem Steuermodul zusammengefasst werden, dass ich Gleissteuermodul nenne. Alle Funktionen dieses Moduls werden mit einem Hybrid-Decoder direkt gesteuert. Der Einsatz von Digital-Decodern bleibt erhalten. Die Steuerdaten eines solchen Gleismoduls ergeben einen Datensatz, der die Basis für seine Steuerung bildet.
Das Bild 2 zeigt die Blockschaltung des Gleissteuermoduls mit seinem Gleis. Wie unschwer zu erkennen ist, sind nun neben den zwei Speiseleitungen aus dem Betriebsstromnetz außerdem vier Gleisanschlussleitungen unvermeidlich. Kurze Leitungen aber ergeben sich, wenn das Gleismodul dezentral direkt unter dem Gleis montiert wird.
Weiterhin benötigt jeder zusätzliche Sensor mindestens eine Doppelleitung.
Schnittstellen für weitere an das Gleis gebundene Funktionen ermöglichen z. B. die Betätigung einer Schranke, ausgelöst von einem Punkt-Besetztgeber.
Die Stromversorgung aller Schaltungsteile und Elemente des Gleismoduls wird dem Betriebsstrom entnommen. Die Betriebsstromart ist nach Erfordernis zu gestalten (Gleich- oder Digital-Strom). Dabei ist von Vorteil, dass alle notwendigen Steuerfunktionen mit einem vom Hybrid-Decoder gesteuerten Komplex elektronischer Bauelemente standardmäßig für alle Stromarten gestaltet werden können.

Bild 2 Blockschaltbild des Gleismoduls
Die Steuerung der Funktionen erfolgt mit der Software, die zum Leistungsumfang des Steuersystems gehören muss. Dieser muss auch die wichtige Zugortung und Zugverfolgung umfassen (-Feststellen des Fahrzeug/Zug-Standortes und verfolgen seiner Bewegung im Gleissystem einschließlich der Darstellung im Gleisbild der Steuerzentrale auf der Basis seiner Adresse/Namens-).
Die zum Gleismodul gehörende Software ist ähnlich der eines Decoders mit Schalt- und Sensor-Funktionen und erfolgt von der Steuer-Zentrale über einen WLAN-Kanal.
Bei Gleismodulen ist eine einfache Konstruktion einer Leiterplatine im Kartenformat möglich, denn sie können verdeckt oder unterflur auf der Anlage mit relativ kurzen Leitungen verbaut werden. Da nur elektronische Bauelemente und einige elektromechanischen Schnittstellen verwendet werden, wird diese Leiterkarte nicht sehr groß sein.
Ein zentralisierter Einbau mehrerer Gleismodule in die Anlage ist nur ratsam bei kurzen Verbindungsleitungen. Bei diesen Überlegungen gehe ich aber davon aus, dass Überfluranlagen selten die Ausbaustufen erreichen, die von Unterfluranlagen bekannt sind.
Der verdeckte Einbau bietet die Möglichkeit, Gleismodule zu vereinheitlichen. Ein Fakt, der wegen hoher Losgrößen kostengünstig wirkt. Trotzdem kann man einwenden, dass für viele Anwendungsfälle das hier beschriebene Gleismodul überdimensioniert ist. Denn für manche Gleise werden mehr Funktionen angeboten als erforderlich sind. Die Erfahrung aber zeigt, dass elektronische Baugruppen oder Einrichtungen kostengünstiger hergestellt werden, je größer ihre Anzahl ist. Der Aufwand für nicht genutzte elektronische Bauelemente ist dann nicht entscheidend. Außerdem können Produkte mit unterschiedlichen Funktionen durch Weglassen von Elementen oder mit Schnittstellenvarianten gefertigt werden (-siehe Decoder mit ihren Varianten-). Letztlich ist das auch eine Frage der ökonomischen Betrachtung.
Denkbar ist auch, dass mehrere Gleise mit weniger Funktionen (Abstell- und Rangiergleise) gemeinsam mit einem Gleismodul gesteuert werden. Beispielsweise können drei Rangiergleise mit den drei Ausgängen eines Gleismoduls a, b, c überwacht und gesteuert werden. Da die Fahrzeuge selbst direkt gesteuert werden, ist das eine vereinfachte Betriebsform.
Für den Decoder des Gleismoduls ist eine geeignete Schnittstelle vorzusehen. Für Anschlüsse der Gleise bzw. anderer Objekte sind verpolungssichere Steckverbinder wegen der dadurch einfacheren Unterflur-Handhabung vorzusehen. Man muss hierbei bedenken, dass Unterflurarbeiten recht unbequem sind.
Abschließend
sei bemerkt, dass die Vorteile der Anwendung der Gleismodule hinsichtlich einer weitgehend automatisierten Steuerung des Modellbahnbetriebes und seiner dadurch deutlich vereinfachten Bedienung
nur Sinn machen, wenn alle Gleise eines Gleissystems mit Steuermodulen ausgestattet sind. Denn nur so ist bei einem späteren Ausbau des Steuersystems die Einfügung ergänzender Steuerkomponenten
möglich.
Optionale Funktionen:
Das den Fahrstrom beeinflussende Schaltelement, lässt sich auch mit entsprechend erweiterter Steuerschaltung und Software optional dazu zu verwenden, den Fahrstrom direkt im Gleismodul zu modulieren beziehungsweise zu codieren. Voraussetzung dafür ist die Verwendung von Hybrid-Decodern zur Steuerung des Gleismoduls, weil dafür die von der Zentrale gesendeten Steuerdatensätze erforderlich sind.
Nutzt man diese Option, dann kann der Fahrstrom im Gleismodul direkt für jedes Digitalsystem codiert oder auch direkt mit PWM (Puls-Weiten-Modulation) für Analog-Modelle moduliert werden. Das heißt, der Fahrstrom kann individuell jedem im Gleis befindlichen Fahrzeug angepasst werden. Das gilt für den Vollbetrieb einer ganzen Anlage mit einem ausgewähltem System oder für verschiedene Anlagenbereiche, wie auch für das jeweils im Gleis vorhandene Fahrzeug mit beliebigem Fahrstrom-System (System-Wechselbetrieb). So können auch ältere Analogfahrzeuge betrieben werden.
Diese Option stellt aber höhere Anforderungen an die Software des Steuersystems. Die zusätzlichen Anforderungen beziehen sich auf die Koordination der Fahrzeugdaten mit denen der Gleismodule. Auf jeden Fall wäre es im Interesse späterer Erweiterungen sinnvoll, wenn die Option sowohl bei der Gleismodul-Hardware wie auch bei ihrer Software vorbereitet ist.
Mit dem gepulsten Gleichstrom ist der Betrieb von reinen analogen Gleichstrom-Fahrzeugen ohne die lästige 5 Volt-Schwelle möglich. Das ist für hartnäckig am Analogbetrieb festhaltende Modellbahner interessant, weil sie mit dieser Technik auch ihre Analoganlage automatisieren können.
Wenn also die Gleismodule diese von der Software gesteuerte Option besitzen, kann reiner Analogbetrieb in den zu befahrenden Gleisen eingeschaltet werden. Damit sind zwei Fahrstrom-Arten am Gleis möglich, Digitalstrom- oder pulsmodulierter Gleichstrom (PWM).
Mit PWM wird die Geschwindigkeit wie bei Digital-Fahrzeugen digital in Stufen gesteuert, die Fahrtrichtung mit Hilfe der Umpol-Funktion des Gleismoduls.
Abschließend ist festzuhalten, dass Gleismodule die Möglichkeit bieten, die bisher nur wenig genutzten Funktionen des Gleises mit dem Einsatz der Direktsteuerung und für Quittungs- und Dialog-Betrieb geeigneter Steuer-Software zu automatisieren und somit beträchtliche Bedienungserleichterungen zu erreichen.